|
Home - Bilderwelten - Pathos als Alterität
|
|
Eckhard Nordhofen Se non e vero e ben trovato. Wir waren schon sehr enttäuscht, als wir in Luthers Studierstube auf der Wartburg den legendären Tintenfleck an der Wand nicht mehr zu sehen bekamen, die Spur jener sanguinischen Eruption, mit der der Junker Jörg, der Kraftmensch und Bibelübersetzer, sein Tintenfass nach dem Teufel sollte geschmissen haben: Wenn nicht wahr, so doch gut erfunden. Zu der Geschichte gehört auch, dass der Kastellan der Wartburg von Zeit zu Zeit den Fleck auffrischen musste, weil reliquiensüchtige Protestanten den Putz Stück für Stück hatten mitgehen lassen. Wir wollen Spuren sehen, Spuren von Krafttaten, möglichst authentischen Ekstasen, Geniestreiche an der Wand, auf Leinwand oder Papier. Seit der frühen Neuzeit gibt es eine Faszination für das Disegno. In der „hingeworfenen“ Skizze, der Invention sind wir ganz nahe beim Einfall, beim Genieblitz, der ersten ursprünglichen Idee, von der ein Kunstwerk seinen Ursprung nimmt. Hier sind das Individuum und sein Ausdruck ganz nahe beieinander. Solche Spuren des Ursprungs zu suchen und zu finden, ist verwandt mit der Verehrung für jene Örtlichkeiten, die wir aufsuchen, damit wir hinterher sagen können, wir seien dort und dabei gewesen. Mit Giorgio Vasaris Künstlerviten lässt man gewöhnlich die Kunstgeschichte beginnen. Dabei ist von vornherein klar: Kunstgeschichte ist Künstlergeschichte, und ins Buch der Geschichte schreibt sich der Künstler durch sein Genie und eine je eigene Leistung ein, die ihm dann im Buch und als buchenswerte Tat zugerechnet werden kann. Der kulturrevolutionäre Umbruch, der sich selbst als „Renaissance“ deutete, denunzierte den Weg, den die christliche Kunst in der Abkehr vom Mimesis-Ideal Wir müssen etwas vermissen. Ebenso ist es mit der Abwesenheit der Bilder. Dass sie nicht da sind, reicht nicht aus. Sie müssen, wie heutzutage bei Arnulf Rainer durchgestrichen, negiert werden. Nur so ist die Negation beredt. Nur so hat sie etwas zu „sagen“. Es käme also darauf an, die Bilder so zu organisieren, dass sie eine Latenz eröffnen, dass sie, indem sie etwas zeigen, gleichzeitig etwas verhüllen und entziehen. Die Idee des gelungenen Bildes heißt: Anwesenheit und Abwesenheit zugleich. Dies war der ästhetische Ansatz des Ikonenparadigmas. Mimetische Weltverdopplung, wie sie in den Malerlegenden des Plinius als antikes Kunstideal erscheint, der Tromp l’ Oeil-Effekt kommt für heilige Sujets um den Preis der Blasphemie nicht in Frage. Die Alterität des Heiligen wird durch die Andersartigkeit markiert, mit der es „aufgeschrieben“ wird. Es ist der heilige Lukas, als Evangelist Schreiber heiliger Schrift, der nach der Legende die erste Ikone der Inkarnation, die Mutter mit dem Christuskind „schrieb“. Ikonenschreiben und Schriftschreiben sind erkenntnis- und ästhetiktheoretisch gleichwertig. Mit großer Geste verwerfen Georgio Vasari und sein Zeitalter der Renaissance diesen Ansatz der Alteritätsmarkierung. Das Anders-Wollen des Ikonenparadigmas wird als Nicht-Können denunziert. Die Faszination der mimetischen Kunst, der Zauber der alten, aus dem Schutt der Antike ausgegrabenen Kunstwerke und ihre handwerkliche Virtuosität entfalten am Ende des Mittelalters wieder neu ihren Zauber. Ars imitatur naturam, das alte Mimesis-Ideal, feiert buchstäblich fröhliche Urständ. Doch was ist mit dem Heiligen? Sind die Helden Vasaris und seines Zeitalters, also Raphael, Michelangelo und Leonardo, etwa keine guten Christen mehr, haben sie das Zweite Gebot vergessen? So könnte es in der Tat erscheinen. Von Anfang an werden die Fresken der Sixtina theologisch inkriminiert. Anstößiger noch als die nackten Genitalien ist die schamlose Sichtbarkeit des Unsichtbaren. Seitdem wettern die Religionspädagogen unverdrossen gegen den „alten Mann mit Bart“, den Buonarotti sich ausstrecken lässt nach Adam, seinem „Ebenbild“. Was die religionspädagogischen Kritiker übersehen, ist die gleichzeitige Erfindung eines neuen Alphabets der Alteritätsmarkierung, das just in dem Moment, in dem die alten Koordinaten des Ikonenparadigmas nicht mehr verstanden werden, vorbuchstabiert wird. Die neue Alteritätsmarkierung heißt Pathos und zielt im heraufziehenden Äon des Individuums auf Transgression und Exaltation. Es ist ein zutiefst theologisches Pathos, mit dem wir es zu tun haben, denn Leiden ist nicht nur die Präsenz der Schmerzen sondern auch der gedachte Gegensatz zum Tun. Dafür steht die ursprüngliche monotheistische Einsicht, dass ein selbstgemachter Gott kein Gott ist, dass wir manches machen können, nur nicht Gott Konkurrenz. Der göttliche, der eschatologische Vorbehalt ist das Reservat des „ganz Anderen“. Dies ist der Sinn der Offenbarung, dass das, was Gott macht, von uns empfangen und erlitten wird. Die Sujets des Barockzeitalters sind daher fast ausschließlich Szenen des Leidens. Es geht um die Ekstase, die Entrückung, die nicht hergestellt ist sondern ein Gnadengeschenk, das erlitten wird, wie eine Stigmatisierung. Oft ist dieses Leiden auch in der Darstellung von Martyrien ein buchstäbliches körperliches Leiden. Die Urszene des Erzmärtyrers Stephanus wird aufgerufen: „Ich sehe den Himmel offen!“ Der „himmelnde Blick“ von Guido Reni zur Spitzmarke multipliziert, wird zum Indikator des Überschwangs. Visionen, passagere Situationen, Übergänge vom Leben zum Tod, zum himmlischen Leben, die himmlischen Feste, die auratische Präsenz der Heiligen in ihrer Sphäre, das sind die neuen Sujets der Alterität. Schließlich die Orgien des Verschwindens, die Darstellung des Entzugs, die Auflösung von Kontur und Gestalt im Licht der barocken Kirchenkuppeln. Mag sein, dass dem ersten, der die nach oben verdrehten Augen eines himmelnden Blickes sah, eine Gänsehaut überlief. Das Pathos ins Massenhafte multipliziert, führt das Zeitalter zur Übersättigung. Es war wohl Aby Warburg, der mit seinem Begriff „Pathosformel“ den Punkt traf. Formelhaftes Pathos, was soll das sein? Im Zeitalter des Individualismus ein oxymorontischer Gedanke, eine Selbstwiderlegung. Nachdem die barocke Körperrhetorik alle Posen der Verzückung, alle Demutsgesten und Positionen der Verzweiflung tausendfach durchbuchstabiert hatte, waren alle Pathosformen „ausgeforscht“, um einen Begriff Thomas S. Kuhns zu benutzen, des Wissenschafts- und Kulturhistorikers, auf den der Begriff vom Paradigmenwechsel zurückgeht. Mit dem barocken formelhaften Pathos ist freilich jene andere Pathetik nicht zu Ende gekommen, die der Individualismus immer neu produziert. Unser auf Individualität, Authentizität und Originalität festgelegtes Geniebild des Künstlers verordnet einerseits Innovation und verhindert so die Formelhaftigkeit des Pathos, ist aber auf die Metaformel des Innovationszwangs festgelegt. Das „Zeige deine Wunde!“ des Josef Beuys ist eine wichtige Station. Sie ist deswegen erkenntnisfördernd, weil wir inzwischen merken, wie manieristisch es wirkt, wenn das Wundenzeigen zu einer Massenchoreografie wird. Wäre da etwas zu lernen? Pathosformeln gibt es schließlich nicht nur im 18. Jahrhundert, in diesem Begriff steckt das Problem einer Alteritätsmarkierung, die sich auf Individualismus verpflichtet hat.
|
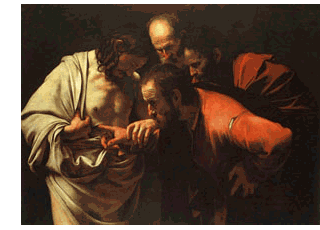 der Spätantike genommen hatte, als Irrweg. Der große Bilderstreit, der sich im jungen Christentum Jahrhunderte lang mit der Frage herumschlug, ob es eine Mimesis des Heiligen geben könne, fand zwischen dem radikalen Bilderschweigen und der Verletzung des Bilderverbots, des zweiten der Zehn Gebote, einen dritten Weg, den man das Ikonenparadigma nennen kann. Das Schweigen, gleich ob es ein Bilderschweigen oder ein Schweigen mit Worten ist, hat eine eigene Faszination, dies aber nur dann, wenn es ein beredtes Schweigen ist. Die Wörter müssen abwesend gemacht werden, von selbst sind sie es nicht. Das große Schweigen ist ein Schweigen der Latenz.
der Spätantike genommen hatte, als Irrweg. Der große Bilderstreit, der sich im jungen Christentum Jahrhunderte lang mit der Frage herumschlug, ob es eine Mimesis des Heiligen geben könne, fand zwischen dem radikalen Bilderschweigen und der Verletzung des Bilderverbots, des zweiten der Zehn Gebote, einen dritten Weg, den man das Ikonenparadigma nennen kann. Das Schweigen, gleich ob es ein Bilderschweigen oder ein Schweigen mit Worten ist, hat eine eigene Faszination, dies aber nur dann, wenn es ein beredtes Schweigen ist. Die Wörter müssen abwesend gemacht werden, von selbst sind sie es nicht. Das große Schweigen ist ein Schweigen der Latenz.