Ulrich Greiner
Ich möchte lieber nicht
Rückblick auf die zehnte documenta (1997)
Hoch droben am alten Bahnhof in Kassel stürmt ein Mann den Himmel. Auf einer gewaltigen, schräg geneigten Stange läuft er hinauf. Was er vorhat, kann nicht gelingen, sein Sturz scheint unvermeidlich. Aber immer noch, seit fünf Jahren schon, enteilt er der Erde und verkündet die frohe Botschaft von Aufbruch und Neubeginn. Damals, auf der neunten documenta, stand Jonathan Borowskis Skulptur noch unten auf der Wiese vorm Friedericianum, das die zentralen documenta-Räume beherbergt. Heute wendet ihnen der Himmelsstürmer den Rücken zu.
Angenommen, es käme ein Besucher vom Himmel in den Bahnhof von Kassel, wo die documenta ihren Anfang nimmt, und man sagte ihm, dies sei die bedeutendste 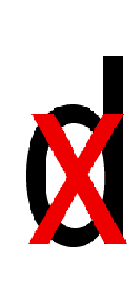 internationale Ausstellung zeitgenössischer bildender Kunst - was würde der Besucher sehen und lernen? Er sähe überall das Schild „Kunstwerke bitte nicht berühren!“, und er wäre dankbar für den Hinweis. Die verrosteten Gleise, zwischen denen Unkraut sprießt, zeugen nämlich nicht von der Schlamperei der Bundesbahn, sondern vom Kunstschaffen des Österreichers Lois Weinberger. Der nennt es spontaneous vegetation. Und wenn der Besucher den Seitenflügel des „Kulturbahnhofs“ umrundet, wird er auf eine eingezäunte Baustelle stoßen. Hier ist der Bürgersteig vor längerer Zeit aufgerissen worden, und spontaneous vegetation hat sich ausgebreitet. Die Baustelle heißt broken asphalt, darf nicht berührt werden und stammt ebenfalls von Weinberger.
internationale Ausstellung zeitgenössischer bildender Kunst - was würde der Besucher sehen und lernen? Er sähe überall das Schild „Kunstwerke bitte nicht berühren!“, und er wäre dankbar für den Hinweis. Die verrosteten Gleise, zwischen denen Unkraut sprießt, zeugen nämlich nicht von der Schlamperei der Bundesbahn, sondern vom Kunstschaffen des Österreichers Lois Weinberger. Der nennt es spontaneous vegetation. Und wenn der Besucher den Seitenflügel des „Kulturbahnhofs“ umrundet, wird er auf eine eingezäunte Baustelle stoßen. Hier ist der Bürgersteig vor längerer Zeit aufgerissen worden, und spontaneous vegetation hat sich ausgebreitet. Die Baustelle heißt broken asphalt, darf nicht berührt werden und stammt ebenfalls von Weinberger.
Der Besucher begreift, daß ein Gang durch Kassel nicht ohne Risiken zu haben ist. Alles kann sich jäh in Kunst verwandeln. Er hätte es zum Beispiel für eher unwahrscheinlich gehalten, daß das graue, durch die Räume und Mauern des alten Bahnhofsgebäudes geführte Abwasserrohr ein Kunstwerk sei, aber im letzten Raum endet das Rohr in Mundhöhe, und der Besucher liest die Aufforderung des Künstlers Matthew Ngui: „If you wish to communicate with this installation please speak clearly into the tube.“
Ich möchte lieber nicht, sagt leise der Besucher und unterquert den Bahnhofsplatz. Er befindet sich in einer finsteren Passage, einer Vorhölle posturbanen Lebens. Die Kachelwände mit den zerfetzten Plakaten und Graffiti, die leeren Vitrinen und das trübe Licht wirken nicht viel schrecklicher als anderswo auch. Aber plötzlich hallt ein furchtbarer Lärm, ein metallisches Krachen durch den Gang. Hinter einer verstaubten Glasscheibe steht ein Monitor und zeigt einen Mann im Nahkampf mit einem Zigarettenautomaten. Wütend tritt der Mann auf den Kasten ein. Der Besucher, der sich schon ein bißchen gefürchtet hatte, versteht nun, daß auch diese Passage bloß ein Kunstwerk ist, und das erleichtert ihn. Vorsichtig möglichen Kunstwerken ausweichend wandert der Besucher durch die Stadt hinab ins Friedericianum. Dies ist ein Museum, so sagt er sich, und was ich darin sehe, werde ich unzweifelhaft als Kunst betrachten müssen. Daß zum Beispiel Gerhard Richter einen riesigen Raum mit fünftausend sorgfältig gerahmten Urlaubs- und Familienphotos ausstaffiert hat, ist keine geringe Leistung. Und während der Besucher durch die Räume schlendert, merkt er, daß er nun doch schon einiges gelernt hat: Daß die documenta-Kunst den Unterschied zwischen Kunst und Nichtkunst annihiliert; und daß, zweitens, der documenta-Künstler diese Vernichtung durch die Vernichtung von Ausstellungsraum erzielt. Das geht mit vielen kleinen Photos ebensogut wie mit wenigen großen. Jeff Wall zeigt fünf Schwarz-Weiß-Photos, ein jedes annähernd von der Fläche einer Sozialbauwohnung, und was man auf den Bildern sieht, hat eine gewisse Ähnlichkeit mit jener.
Kein anderer soll neben mir sein – dieser Wunsch war den Künstlern nie fremd. Aber ihre Möglichkeiten waren früher begrenzt. Mit Wehmut denkt der Besucher an die alten Meister und an die Arbeit, die es sie kostete, einen Quadratmeter Leinwand mit Anstand zu füllen. Liisa Roberts füllt einen Raum von der Größe eines Vortragssaales mit dem Kunststück, auf einer Leinwand immer dieselbe rasche Kamerafahrt um einen Brunnen herum zu zeigen. Seitwärts stehen kleinere Projektionsflächen im Dreieck, und drei Videobänder zeigen dieselbe Szene: Das Brustbild einer Frau, die unendlich langsam ihre Handflächen öffnet.
Im Kurzführer liest der Besucher, die Arbeit von Liisa Roberts beruhe auf der Erkenntnis, daß der Film eine optische Täuschung sei, denn bloß 24 Bilder in der Sekunde genügten, um den Anschein von Bewegung zu erzeugen. Frau Roberts arbeite mit einer Aufnahmegeschwindigkeit von tausend Bildern. In der dadurch erzielten extremen Zeitlupe gewännen die Bilder an Gewicht. „Liisa Roberts nutzt und thematisiert die spezifischen Möglichkeiten des Films und schafft gleichzeitig einen neuen, mehrschichtigen Raum, der szenische und räumliche Erfahrungen ermöglicht, die unruhig in Real- und Illusionsraum oszillieren und die permanente Neupositionierung des Betrachters herausfordern.“
Ich möchte mich lieber nicht neu positionieren, sagt sich der Besucher, und wandelt hinüber in das kleine Turmzimmer, dessen Boden Mariella Mosler mit einer Schicht Sand bedeckt und in den sie, wie in japanischen Gärten, geometrische Ornamente hineingepflügt hat. Die Sonne leuchtet durchs Fenster und verleiht dem Sandrelief ein schönes Licht- und Schattenspiel. Der Besucher erinnert sich voller Wehmut (was hat er nur?) an den letzten Urlaub, als er dösend am Strand lag und mit gespreizten Fingern ähnliche Muster in den Sand grub, aber bei weitem nicht so vollkommene. Im Raum darunter duftet es grün und schwül wie im Palmengarten. Olaf Nicolai hat dort einige handliche Felsbrocken versammelt, auf denen, von oben bestrahlt und betropft, allerlei Moose und Farne wachsen: artificial vegetation. Im Hintergrund sieht der Besucher das Leuchtbild eines Tropenwaldes, eingerahmt von einer Streifentapete. Nicolais Wald, Moslers Wüste - dem Besucher fällt Ernst Jandls etüde in f ein: „eile mit feile / durch den fald / durch die füste / bläst der find.“
Der Besucher begreift, daß die documenta-Kunst von zentrifugalen Sehnsüchten getrieben ist. Sie erfindet nicht mehr, sie findet nur. Und sie dokumentiert das Gefundene: im botanischen Archiv, im Zufallsphoto, in der Endlosschleife des Films, in der soziographischen Bestandsaufnahme. Hans Haacke photographiert New Yorker Mietshäuser und recherchiert die Eigentumsverhältnisse im Grundbuchamt. Edgar Honetschläger transportiert Stühle vom New Yorker Sperrmüll nach Tokio und läßt nackte Japaner darauf sitzen. Warum nicht?, fragt sich der Besucher, aber warum? Finden darf man, aber der wahre Finder ist begnadet. Hier sind nur die Nischenfinder.
Das alte Tafelbild ist verschwunden. Nur der schwarze Amerikaner Kerry James Marshall erzählt noch auf bunten, ironischen Bildern vom Leben seiner Landsleute. Es wird in Kassel nicht mehr gemalt oder gezeichnet. Filmregisseure, Architekten, Ökologen, Stadtplaner, Photographen, Computerspezialisten haben den alten Künstler ersetzt. Sie arbeiten wie Journalisten oder Wissenschaftler. Ihnen fällt nichts ein, nur auf. Die Phantasie war einmal an der Macht, jetzt herrscht die Macht der Sachkunde.
Der Besucher eilt hinüber in die documenta-Halle. Hier, in der Vortragsreihe „100 Tage, 100 Gäste“, referieren jeden Abend Philosophen, Kritiker, Kuratoren über die Kunst. In den zum Vortragssaal umgebauten Räumen gibt es sie fast nicht. Der Diskurs hat über die Kunst gesiegt. Die Experte und die Priester sind an der Herrschaft. Aber der Besucher hat Glück, heute fällt der Vortrag aus. Er trinkt einen Kaffee in der Sonne und erinnert sich an die lammfromme Geduld, mit der die Besuchergruppen den jungen Priesterinnen und Priestern der documenta lauschten. Und die Interpretationen gerieten umso länger, je weniger Anschauung und Sinnlichkeit das Kunstwerk bot. Einmal sah er eine meterlange, rhythmisch untergliederte Wurst aus ungewissem Material, in Augenhöhe an der Wand befestigt. Ratlos stand er mit zwei anderen Besuchern vor dem Objekt, und plötzlich strebten sie alle in stummer Gleichzeitigkeit zur Legende an der Wand, hoffend auf Erklärung, dort aber stand nur: Toni Grand Sans Titre.
Der Besucher rüstet sich zum letzten Akt und schreitet in die schönen Auen der Fulda, hinab zur Orangerie, wo er die Auswanderung der Kunst ins Internet besichtigen will. Aber die Werkstatt ist geschlossen, schon den zweiten Tag. Der Besucher grämt sich nicht, das Internet ist überall, dazu braucht er nicht nach Kassel. War das alles? Nein, am Ende entdeckt er hinter einer der messerscharf geschnittenen Buchenhecken, die den Barockpark seitwärts begrenzen, das Monument der sinnlichen Anschauung, das er schon den ganzen Tag vermißte. Er betritt einen grauen Kubus aus Beton, der Gang öffnet sich auf eine Panoramascheibe, und dahinter sind zwei Schweine. Es geht ihnen gut, der Stall ist sauber, sie haben Auslauf auf die grüne Wiese, und Futter ist auch da. Auf die schräge Bodenfläche vor der Scheibe sind säuberlich vier rechteckige Filzplatten geklebt. Dort läßt sich der Besucher nieder und sieht, wie die hereinkommenden Besucher die Schweine sehen. Den Schweinen ist das gleichgültig. Schwein sein auf der documenta, denkt der Besucher, wäre kein schlechter Job. Er erblickt das Schild an der Wand „Ruhe bitte“. Wem gilt das? Schweine sind nervös, das weiß man, aber verhindert nicht die Trennscheibe jegliche Lärmbelästigung der Tiere? Die Aufforderung kann nur dem Meditationsbedürfnis der Besucher dienen. Und in der Tat: Der Anblick der Wiese und der friedlich mampfenden Schweine hat etwas äußerst Beruhigendes.
So versinkt also der Besucher in stille Betrachtung. Was habe ich in den zwei Tagen gesehen?, fragt er sich und denkt an den langen Weg vom Himmel herab zu den Schweinen der Orangerie. Alles, aber nichts; Kunst, aber Nichtkunst, und die Nichtkunst als Etikettenpräpotenz. Also Fluchtbewegungen, Ersatzleistungen und Ausweichmanöver; Paradigmen, Parakunst und Parawissenschaft. Jetzt endlich begreift der Besucher, weshalb Catherine David, die Leiterin der „dX“, die römische Ziffer X groß und rot auf das kleine d gesetzt hat. Sie hat die documenta ausgestrichen, liquidiert. Das ist eine Tat.
Aber weil der Besucher vom Himmel kommt, glaubt er nicht an das Ende der Kunst. Immerzu entsteht sie neu, weil der Mensch kein Schwein und nie zufrieden ist. Der Besucher weiß, daß es Menschen gibt, die noch ahnen, was Kunst ist. Eines Tages werden sie den Schwindel durchschauen. Daß in Kassel das Werk nichts, aber die Intention alles bedeutet – was macht es? Die nächste documenta kommt bestimmt. Und wenn sie nicht kommt – was macht es? Den Besucher ergreift ein tiefer Friede. Es muß an der Aussicht liegen. Die Abendsonne taucht die Schweine in ihr sanftes Licht. Soll er sich ihnen zugesellen? Ist das nicht die unüberhörbare Aufforderung dieses Kunstwerks? Ich möchte lieber nicht, sagt leise der Besucher und geht.